Molybdän ist ein lebensnotwendiges Spurenelement. Es ist Bestandteil von Enzymen. Molybdänhaltige Enzyme sind bei vielen Stoffwechselvorgängen wichtig. Eine Ergänzung könnte Karies vorbeugen, indem es den Einbau von schützendem Fluorid in den Zahnschmelz fördert. Außerdem könnten die Beschwerden einer Sulfitempfindlichkeit gelindert werden. Informieren Sie sich, wann und wie Molybdän in der Mikronährstoffmedizin eingesetzt wird.

Eigenschaften und Vorkommen in Lebensmitteln
Was ist Molybdän?
Molybdän ist ein wichtiger Mineralstoff im Körper. Als Spurenelement wird es nur in winzigen Mengen benötigt. Da es an vielen Stoffwechselvorgängen beteiligt ist, kann das Fehlen jedoch schwere Folgen für die Gesundheit haben. Molybdän ist ein Bestandteil (Cofaktor) von vielen Enzymen. Molybdänhaltige Enzyme werden zum Beispiel bei der Entgiftung benötigt.
In löslicher Form ist Molybdän (Molybdate) in der Umwelt weit verbreitet. Es kommt vor in Wasser, Böden, Bakterien, Pflanzen und Pilzen. In der Landwirtschaft wird Molybdän zur Behandlung des Saatguts oder als Düngemittel verwendet. So gelangt es auch in Lebensmittel.
Info
Molybdän wird ebenfalls in der Industrie eingesetzt – zum Beispiel als Metall in der Stahlherstellung, in elektrischen Geräten, der Automobilindustrie und als Farbstoff.
In welchen Lebensmitteln kommt Molybdän vor?
Molybdän ist in vielen verschiedenen Lebensmitteln enthalten – besonders aber in Hülsenfrüchten, Innereien wie Leber, Getreide- und Vollkornprodukten sowie Milch und Milchprodukten.
Die Menge in Lebensmitteln schwankt jedoch, je nach Gehalt im Boden. Er sinkt besonders, wenn der Dünger kein Molybdän enthält. Auch Umweltfaktoren wie Smog, saurer Regen oder Bleibelastungen senken den Gehalt im Boden und damit die Aufnahme über die Ernährung.
In der industriellen Lebensmittelverarbeitung geht außerdem ein großer Teil des Molybdäns verloren. Beispielsweise fällt fast die Hälfte bei der Mehlherstellung oder bei der Zuckerproduktion weg. Hoch verarbeitete (raffinierte) Lebensmittel haben daher einen niedrigen Gehalt.
Fünf wichtige Molybdän-Lieferanten: | Mikrogramm (µg) pro 100 Kilokalorien (kcal) | Mikrogramm pro 100 Gramm (g) |
|---|---|---|
Rinderleber, gebraten | 93 | 122 |
Spinat, gekocht | 55 | 11 |
Limabohnen, gekocht | 45 | 139 |
Joghurt, fettarm | 34 | 17 |
Milch, 2% Fett | 29 | 15 |
Hinweis: Werte können schwanken.
Bedarf und Funktionen im Körper
Täglicher Bedarf an Molybdän
Als Spurenelement muss Molybdän dem Körper über die Ernährung zugeführt werden. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schätzt, dass der Bedarf für Jugendliche und Erwachsene 50 bis 100 Mikrogramm pro Tag beträgt. Genauere Angaben liegen bisher nicht vor. Dies gilt für Männer und Frauen. Kinder haben wahrscheinlich einen geringeren Bedarf.
Täglicher Molybdänbedarf in Mikrogramm (µg) | |
|---|---|
0 bis 4 Monate | 7 |
4 bis 12 Monate | 20 bis 40 |
1 bis 4 Jahre | 25 bis 50 |
4 bis 7 Jahre | 30 bis 75 |
7 bis 10 Jahre | 40 bis 80 |
Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren sowie Erwachsene | 50 bis 100 |
Aufnahme und Verteilung im Körper
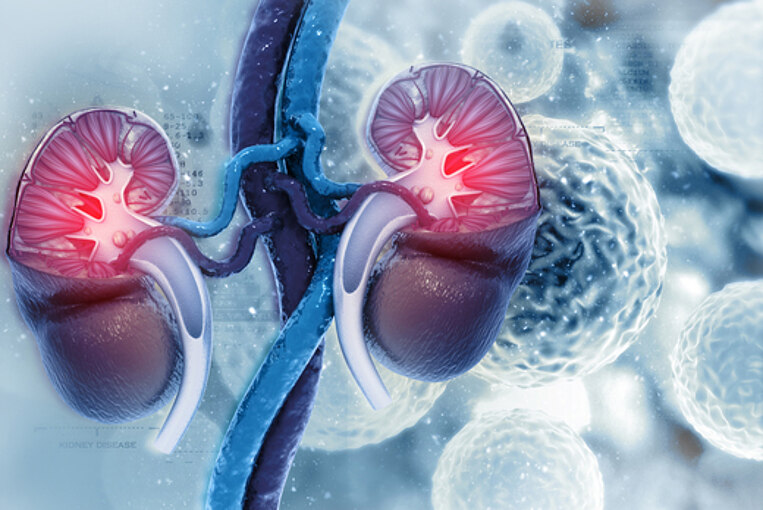
Molybdän aus der Nahrung wird im Dünndarm gut aufgenommen. Etwa 70 bis 90 Prozent gelangen ins Blut. Der Höchstwert wird innerhalb von 40 bis 60 Minuten erreicht.
Aus dem Blut wird Molybdän schnell an die Gewebe abgegeben. Der Gesamtgehalt im Körper beträgt etwa zehn Milligramm. Das meiste kommt in den Knochen und der Leber vor. Hohe Werte werden auch in den Nieren, dem Magen-Darm-Trakt, den Zähnen, den Muskeln und der Haut gemessen.
Molybdän kann nicht gespeichert werden. Nach 24 Stunden ist es aus dem Blut wieder verschwunden. Aus den Geweben wird es unterschiedlich schnell ausgeschieden. Beispielsweise fällt der Wert in den Nieren nach anderthalb bis zweieinhalb Tagen auf die Hälfte. In der Leber ist dies dagegen erst nach 42 bis 74 Tagen der Fall.
Die Ausscheidung von Molybdän erfolgt größtenteils über die Nieren mit dem Urin. Ein kleiner Anteil wird auch über die Gallenflüssigkeit in den Darm abgegeben. Dort wird es entweder über den „Darm-Leber-Kreislauf“ (enterohepatisch) in die Leber zurückgeführt oder mit dem Stuhl ausgeschieden.
Wie wirkt Molybdän?
Molybdän hat zahlreiche Aufgaben im Körper. Das betrifft folgende Bereiche:
Stoffwechsel: Molybdän ist Bestandteil von Enzymen, die an verschiedenen Stoffwechselprozessen beteiligt sind. Dazu gehören:
- Abbau von DNA-Bestandteilen (Purinen): Das Enzym Xanthinoxidase baut DNA-Bestandteile zu Harnsäure ab. Harnsäure ist antioxidativ, führt aber in hohen Mengen zu Gicht. Optimale Molybdänwerte helfen, den Harnsäurespiegel auf einem normalen Niveau zu halten.
- Abbau von Schwefel: Das Enzym Sulfitoxidase hilft beim Abbau von schwefelhaltigen Eiweißverbindungen und Sulfiten aus Lebensmitteln (Zusatzstoff).
- Entgiftung: Das Enzym Aldehydoxidase baut zum Beispiel Fremdstoffe in der Leber ab, wie bestimmte Medikamente.
- Eisenstoffwechsel: Das Enzym Xanthinoxidase ist vermutlich am Transport und der Speicherung von Eisen beteiligt. Eisen braucht der Körper unter anderem für die Blutbildung.
Karies: Molybdän könnte Zahnkaries vorbeugen. Es erhöht die Aufnahme und Speicherung von Fluorid in den Zahnschmelz, wodurch die Zähne weniger anfällig für Karies sind.
Durchblutung: Es gibt Hinweise, dass eine gute Molybdän-Versorgung mit einem niedrigeren Blutdruck verbunden ist. Molybdänhaltige Enzyme fördern die Bildung des Botenstoffs Stickstoffmonoxid (NO). Dieser erweitert die Gefäße, wodurch sich die Durchblutung verbessert.
Krebs: Molybdän könnte gegen Krebs wirken. Es senkt den Kupferspiegel und hemmt dadurch die Neubildung von Blutgefäßen. In Zell- und Tierstudien unterdrückte es so das Tumorwachstum. Auch in ersten Studien mit Menschen während einer Krebstherapie senkte Molybdän die Gefäßneubildung bei Darmkrebs und Brustkrebs. Das Überleben bei Speiseröhrenkrebs konnte ebenfalls verlängert werden. Andererseits diskutieren Forscher, ob Molybdän die Krebsentstehung und das Tumorwachstum durch die Erzeugung von freien Radikalen fördert. Es könnte daher positive und negative Wirkungen haben. Der Einsatz bei der Krebsbehandlung ist noch nicht ausreichend getestet.
Mangel erkennen und beheben
Welche Beschwerden treten bei einem Molybdän-Mangel auf?
Eindeutige Anzeichen für einen Mangel an Molybdän sind bisher nicht bekannt. Es gibt aber Vermutungen: Fehlt es, sinkt die Aktivität molybdänhaltiger Enzyme. Deshalb dürfte der Abbau von Schwefel und Harnsäure gestört sein. Die Folgen wären Unverträglichkeiten für die Aminosäuren Cystein und Methionin. Mögliche Symptome sind Reizbarkeit, Herzrasen, beschleunigte Atmung, Nachtblindheit, Haarausfall oder Müdigkeit.
Auf lange Sicht können Karies, Nierensteine oder Gehirnschäden auftreten. In extremen Fällen kommt es zu einem Koma. Das zeigen Beobachtungsstudien mit Personen, die Molybdän aufgrund eines genetischen Defekts nicht richtig in die Enzyme einbauen können.
Zusätzlich verringert ein Molybdän-Mangel die Fruchtbarkeit. Das zeigen Tierversuche.
Wann ist das Risiko für einen Molybdän-Mangel erhöht?
Ein Mangel an Molybdän ist unter normalen Ernährungsbedingungen selten. Er kann aber bei künstlicher Ernährung vorkommen. Man vermutet, dass eine leichte Unterversorgung (25 bis 50 Mikrogramm pro Tag) häufiger auftritt als ein offensichtlicher Mangel.
Als Ursache einer mangelhaften Versorgung gilt vor allem eine gestörte Darmfunktion. Dann wird Molybdän nicht aufgenommen. Das trifft auf Personen zu, bei denen Darmabschnitte entfernt werden mussten (Kurzdarmsyndrom). Darüber hinaus kann Molybdän über den Darm verloren gehen, wie zum Beispiel bei der chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Morbus Crohn. Man rechnet mit einem Verlust von mehr als 400 Mikrogramm Molybdän pro Tag. Das Risiko für einen Molybdän-Mangel ist daher bei Personen mit Darmerkrankungen erhöht.
Darüber hinaus wäre bei kalorienreduzierten Diäten ein Mangel denkbar. Zusätzlich steigt das Risiko einer Unterversorgung, wenn viele aufgereinigte (raffinierte) Lebensmittel gegessen werden.
Wie erkennt man einen Molybdän-Mangel im Labor?
Die Blutwerte von Molybdän werden üblicherweise nicht erhoben, da sie die Versorgung schlecht wiedergeben: Sie schwanken nach den Mahlzeiten sehr stark. Daher sollte man die Werte nicht kurz nach dem Essen erheben. Außerdem sind sie sehr niedrig und daher grundsätzlich schwer zu messen.
Im Vollblut liegt die übliche Konzentration zwischen zwei bis sechs Mikrogramm pro Liter. Sie kann aber auch Werte von 70 Mikrogramm pro Liter erreichen. Im Blutserum liegt sie bei unter drei Mikrogramm pro Liter. Das Vollblut enthält alle Blutzellen, während das Blutserum zellfrei ist.
Einige Erkrankungen erhöhen die Blutspiegel. Molybdän steigt zum Beispiel bei Entzündungen oder Tumoren in der Leber, einer gestörten Nierenfunktion, rheumatischen Erkrankungen und durch bestimmte Medikamente.
Da Molybdän über die Nieren ausgeschieden wird, kann man es auch im Urin messen. Aber auch die Urinwerte sagen wenig über die Versorgung aus. Sie sind sehr von der Nahrungsaufnahme abhängig. Im Urin werden zwischen zehn bis 16 (sogar bis zu 70) Mikrogramm pro Liter gemessen.
Molybdän im Vollblut in Mikrogramm pro Liter (µg/l) | Molybdän im Blutplasma in Mikrogramm pro Liter (µg/l) | Molybdän im Urin in Mikrogramm pro Liter (µg/l) | |
|---|---|---|---|
Normalwerte | 2 bis 6 (bis zu 70) | unter 3 | 10 bis 16 (bis zu 70) |
Expertenwissen
Ein Mangel an Molybdän löst Stoffwechselveränderungen aus. So kann es begleitend zu erhöhten Methioninspiegeln sowie niedrigen Harnsäurespiegeln im Blut kommen. Vorstufen von Harnsäure (Xanthin und Hypoxanthin) sind dagegen erhöht. Da außerdem die Entgiftung von Sulfaten gestört ist, steigt auch die Konzentration von Sulfit und Thiosulfat im Urin.
Einen Mangel an Molybdän beheben
Für Molybdän wurden bisher keine Dosierungen zur Behandlung eines Mangels festgelegt. In ersten Studien setzten Forscher 150 Mikrogramm pro Tag ein, um die Symptome zu beheben.
Bei einem Mangel aufgrund eines Kurzdarmsyndroms oder einer Darmerkrankung wie Morbus Crohn kann der Arzt auch höhere Dosierungen über eine Infusion in die Vene geben – zum Beispiel täglich 500 Mikrogramm. Dabei kann es sinnvoll sein, die Eiweißaufnahme kurzzeitig zu verringern. Hintergrund ist, dass die Entgiftung von nicht benötigten Eiweißen bei einem Mangel an Molybdän nicht ausreichend funktioniert (Sulfat- und Harnstoffstoffwechsel).
Einsatz bei Krankheiten
Schützt Molybdän vor Karies?
Molybdän könnte Zahnkaries vorbeugen und eine Verschlechterung von bestehender Karies hemmen. Es gibt Hinweise, dass es die Aufnahme und den Einbau von Fluorid in den Zahnschmelz fördert. Dadurch werden die Zähne weniger anfällig für Karies, denn Fluorid hemmt das Wachstum von Kariesbakterien. Auch bindet und neutralisiert es zahnschädigende Säuren. Dabei wird Fluorid jedoch aus dem Zahnschmelz herausgelöst und muss ersetzt werden. Molybdän könnte indirekt vor Karies schützen, indem es den Fluoridgehalt der Zähne erhöht.
Einige Tierversuche lassen vermuten, dass Molybdän Karies hemmt. Ein Laborversuch zeigte auch, dass es den Wiederaufbau des Zahnschmelzes fördert. Andere Labor- und Tierversuche bestätigten das jedoch nicht. Außerdem fanden Forscher in erkrankten Zähnen höhere Mengen an Molybdän als in gesunden Zähnen. Das steht im Widerspruch zu den anderen Ergebnissen. Bisher ist unklar, warum das so ist.
Erste Untersuchungen bei Menschen sind wiederum vielversprechend: In einer Beobachtungsstudie schlussfolgerten Forscher, dass ein hoher Molybdän-Gehalt in Böden und Trinkwasser mit einer geringeren Häufigkeit von Karies in der Bevölkerung verbunden ist. Dasselbe zeigt eine andere Beobachtungsstudie mit Kindern: Bei molybdänreicher Ernährung war Karies seltener.
Fazit: Es wird angenommen, dass Molybdän gegen Karies wirkt. Allerdings sind sich die Forscher bisher nicht einig. Auch liegen noch keine hochwertigen Studien mit Menschen vor. Dennoch wird Molybdän vermutlich für gesunde Zähne benötigt. Zur Vorbeugung von Karies sollte auf eine ausreichende Versorgung geachtet werden. Sinnvoll sind täglich 50 bis 100 Mikrogramm.
Tipp
Zur Kariesvorbeugung empfiehlt sich eine Kombination von Molybdän und Fluorid, da beide Mineralstoffe zusammenwirken. Außerdem spielt die richtige Mundhygiene eine entscheidende Rolle. Sie sollte nicht vernachlässigt werden.

Sulfitempfindlichkeit: Molybdän lindert die Symptome
Das molybdänhaltige Enzym Sulfitoxidase ist an der Ausscheidung von Schwefel (Sulfit) beteiligt. Schwefel stammt aus Eiweißen. Dabei wandelt das Enzym problematisches Sulfit zu Sulfat um. Sulfat wird anschließend über den Urin ausgeschieden.
Durch einen Molybdän-Mangel kann demnach eine Sulfitempfindlichkeit ausgelöst werden. Zu viel Sulfit im Körper verursacht Symptome wie Atembeschwerden, Hautreaktionen und Magen-Darm-Probleme. Es verschlimmert außerdem Asthmasymptome. Ein Fallbericht mit einem Asthmatiker deutet darauf hin, dass Molybdän bei einer Sulfitempfindlichkeit hilft: Es besserten sich Beschwerden wie das pfeifende Atemgeräusch. Auch der Bedarf nach Asthmamedikamenten sank auf die Hälfte. Die Ergänzung verringerte bei zwei weiteren Asthmatikern die Belastung mit Sulfit im Urin und verbesserte die Sulfatausscheidung.
Fazit: Molybdän könnte eine Sulfitempfindlichkeit lindern, wenn sie durch eine Unterversorgung mit Molybdän verursacht wurde. Bisher fehlen jedoch hochwertige Studien. Versucht werden können 120 bis 150 Mikrogramm pro Tag. Die Behandlung sollte in Rücksprache mit dem Mikronährstoff-Experten erfolgen.
Info
Sulfite kommen auch in Lebensmitteln als Zusatzstoff vor. Sie sind vor allem in Wein enthalten. Weitere Lebensmittel die „geschwefelt“ werden, sind Trockenfrüchte. Je nach individueller Empfindlichkeit reagieren einige Menschen schon auf geringe Mengen mit Übelkeit und Kopfschmerzen. Auch ein Zusammenhang mit Allergien wird diskutiert.
Betroffene sollten ausschließen, dass sie schlecht mit Molybdän versorgt sind, um die Beschwerden nicht zusätzlich zu verstärken.
Dosierungen auf einen Blick
Dosierungsempfehlung von Molybdän am Tag in Mikrogramm (µg) | |
|---|---|
Karies | 50 bis 100 |
Sulfitempfindlichkeit | 120 bis 150 |
Einnahmeempfehlung
Wann und wie sollte man Molybdän einnehmen?
Im Normalfall nimmt man Molybdän durch die Ernährung in ausreichender Menge auf. Dafür reichen beispielsweise eine Portion Bohnen oder ein Glas Milch und eine Portion Spinat am Tag.
Wenn der Bedarf über die Ernährung nicht gedeckt werden kann – zum Beispiel bei einer Magen-Darm-Erkrankung – können Präparate sinnvoll sein. Auch empfehlen Mikronährstoff-Experten manchmal für einen gezielten Einsatz Präparate. Meist sind sie als Kapseln erhältlich.
Molybdän sollte zum Essen mit etwas Flüssigkeit eingenommen werden. So wird es besser vertragen.
Was macht ein gutes Molybdän-Präparat aus?
Molybdän ist in unterschiedlichen Formen in Präparaten enthalten. Gut aufgenommen wird es wahrscheinlich als Natriummolybdat oder Ammoniummolybdat. Zusätzlich gibt es noch die organischen Verbindungen Molybdänpicolinat, Molybdäncitrat und Molybdänaspartat.
Hochwertige Präparate sind außerdem frei von allergieauslösenden Substanzen und Verschmutzungen. Seriöse Hersteller achten besonders auf die Qualität. Auch sollten keine Süßungsmittel und Zusatzstoffe wie Farb- oder Aromastoffe enthalten sein.
Expertenwissen
Bei einigen Erbkrankheiten muss auf die Einnahme von ganz bestimmten Molybdän-Verbindungen für eine Wirkung geachtet werden. Zum Beispiel darf beim Molybdän-Cofaktor Mangel (Typ 1) nur das cyclisches Pyranopterin-Monophosphat eingesetzt werden.
Überdosierung, Wechselwirkungen und Hinweise bei Erkrankungen
Kann Molybdän überdosiert werden?
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) stuft eine maximale Zufuhr von 600 Mikrogramm Molybdän pro Tag für Erwachsene als sicher ein. In den USA wird sogar eine Obergrenze von 2.000 Mikrogramm täglich angegeben (Institute of Medicine).
Da man über die Ernährung zwischen 100 und 460 Mikrogramm Molybdän pro Tag aufnimmt, hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Deutschland Empfehlungen für Präparate abgeleitet. Demnach sollten dauerhaft nicht mehr als 80 Mikrogramm pro Tag zusätzlich ergänzt werden. Bei höheren Mengen ist eine Rücksprache mit dem Arzt oder Mikronährstoff-Experten empfehlenswert.
Eine Überversorgung an Molybdän scheint selten zu sein. Wahrscheinlich wird sie durch eine schnelle Wiederausscheidung über den Urin verhindert. Bei einer Überdosis (ab etwa 10.000 Mikrogramm) steigt die Aktivität der molybdänhaltigen Enzyme. Als nachteilige Auswirkungen kann es zu hohen Harnsäurespiegel im Blut sowie Urin und Gelenkschmerzen kommen (wie bei Gicht). Zudem wurden Nieren- und Leberschäden, Blutarmut und Durchfall beobachtet. Bei Kindern kann eine Überdosierung zu Wachstumsverzögerung und Fehlbildungen der Knochen führen. Auch wird diskutiert, ob überdosiertes Molybdän Krebs begünstigt.
Wechselwirkung mit Kupfer, Selen, Eisen und Sulfat
Sehr hoch dosiertes Molybdän kann die Aufnahme und teilweise auch den Stoffwechsel anderer Mineralstoffe beeinträchtigen. Das wurde für 10.000 Mikrogramm Molybdän pro 100 Gramm Lebensmittel festgestellt. Beeinflusst werden Selen, Kupfer, Eisen und Zink. Wird Molybdän länger in hoher Dosierung eingenommen (zum Beispiel 500 Mikrogramm), sollten deshalb die Blutspiegel der Mineralstoffe kontrolliert werden. So erkennt der Arzt oder die Ärztin einen Mangel rechtzeitig.
Im Rahmen einer hoch dosierten Mikronährstofftherapie sollten die Mineralstoffe außerdem zeitversetzt eingenommen werden. Bei einer geringen Dosierung ist kein deutlicher Effekt anzunehmen, denn auch in Lebensmitteln liegen immer mehrere Mineralstoffe zusammen vor.
Info
Den kupferreduzierenden Effekt von Molybdän könnte man sich bei der Kupferspeicherkrankheit (Morbus Wilson) zu Nutze machen. Bei Morbus Wilson wird Kupfer wegen eines genetischen Defekts nicht ausreichend ausgeschieden. Es kommt zu einer Kupfervergiftung. Meist sind Leberschäden die Folge. Derzeit wird an der Wirkung spezieller Molybdän-Formen (Tetrathiomolybdat) geforscht. Sie hemmen wahrscheinlich die Aufnahme von Kupfer und fördern dessen Ausscheidung. So reichert es sich nicht weiter im Körper an.
Molybdän könnte Paracetamol beeinflussen
Bei regelmäßiger Einnahme von Paracetamol sollte auf eine hohe Molybdän-Dosis verzichtet werden. Molybdän könnte die Ausscheidung von Paracetamol senken: In Tiermodellen hemmte eine hohe Dosis den Stoffwechsel von Paracetamol. Untersuchungen am Menschen müssen noch folgen.
Zu beachten in der Schwangerschaft und Stillzeit
Molybdän ist in der Schwangerschaft und Stillzeit in geringen Mengen ungefährlich, jedoch in hohen Dosen problematisch. Im Tiermodell kam es dann zu Entwicklungsstörungen und Fehlgeburten. Außerdem könnten hohe Dosen den Zuckerstoffwechsel verändern (Schwangerschaftsdiabetes).
Daher muss auf die Dosis geachtet werden: Die höchste sichere Aufnahmemenge in der Schwangerschaft und Stillzeit aus Lebensmitteln und Präparaten wird auf 600 Mikrogramm Molybdän geschätzt. Halten Sie zur Sicherheit Rücksprache mit Ihrem Arzt.
Einnahmehinweise bei Nierenschwäche
Molybdän wird hauptsächlich über die Nieren mit dem Urin ausgeschieden. Personen mit Nierenschwäche, insbesondere Dialysepatienten, sollten daher Molybdän nur unter ärztlicher Kontrolle ergänzen. Es könnte die Nieren zusätzlich belasten oder sich im Körper anreichern.
Molybdän könnte bei Diabetes zu Gefäßschäden führen
Bei Diabetes könnte Molybdän positiv und negativ wirken, besonders auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Vermutlich erzielt eine Ergänzung immer dann positive Effekte, wenn ausreichend Antioxidantien zur Verfügung stehen: Zusammen mit Vitamin C besserte Molybdän eine mit Diabetes verbundene Herzschwäche (Insuffizienz).
Andererseits gibt es auch negative Ergebnisse: Ein Molybdän-abhängiges Enzym (Xanthinoxidase) kann vermehrt oxidativen Stress produzieren. Dieser kann wiederum Folgeerkrankungen wie Nervenschäden oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen.
Bei Diabetes und einer hoch dosierten Ergänzung von Molybdän sollte daher der oxidative Stress von einem Arzt oder Mikronährstoff-Experten überwacht werden. Außerdem sind Antioxidantien wie Vitamin C und E wichtig. Eine gute Versorgung sollte gewährleistet sein.
Vorsicht bei akutem Schlaganfall und Herzinfarkt sowie bei akuten Entzündungen
Molybdänhaltige Enzyme können in bestimmten Situationen oxidativen Stress verstärken. Das ist der Fall, wenn die Blutversorgung akut unterbrochen ist (Schlaganfall und Infarkt) oder wenn starke Entzündungen vorliegen.
Bevor Molybdän hoch dosiert eingesetzt wird, sollte die Blutversorgung verbessert oder die Entzündung behandelt werden. Wichtig ist außerdem, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einer hoch dosierten Einnahme von über 100 Mikrogramm, für eine ausreichende Zufuhr an Antioxidantien zu sorgen. Die Beratung durch einen Mikronährstoff-Experten ist dabei sinnvoll.
Vorsicht bei Gicht

Bei Gicht sollten man mit der Ergänzung vorsichtig sein: Ein molybdänhaltiges Enzym (Xanthinoxidase) sorgt für die Bildung von Harnsäure. Aus Harnsäure bilden sich bei Gicht wiederum Kristalle in den Gelenken. Das führt zu den typischen Gelenkbeschwerden.
Hohe Dosen Molybdän zwischen 10.000 und 15.000 Mikrogramm täglich können die Harnsäurespiegel zu stark anheben. Bei Gicht sollte es deshalb nicht hoch dosiert eingenommen werden.
Zudem ist unklar, ob die Wirkung von Gichtmedikamenten (Urikostatika) durch hoch dosiertes Molybdän abgeschwächt wird. Einige Medikamente hemmen die Aktivität des molybdänhaltigen Enzyms Xanthinoxidase, Molybdän dagegen verstärkt sie. Zu Medikamenten gegen Gicht gehört zum Beispiel der Wirkstoff Allopurinol (wie Bleminol®, Cellidrin®). Die Einnahme dieser Medikamente und Molybdän sollt nur in Absprache mit einem Arzt erfolgen.
Zusammenfassung
Molybdän ist ein wichtiger Mineralstoff. Es zählt zu den Spurenelementen, da es nur in kleinen Mengen gebraucht wird. Diese sind jedoch lebensnotwendig. Die meisten Lebensmittel enthalten das Spurenelement – darunter vor allem Innereien wie Leber, Getreide- und Vollkornprodukte sowie Milch und Milchprodukte.
Molybdän hat im Körper viele Funktionen. Es könnte vor Karies schützen, denn es fördert die Aufnahme von Fluorid in den Zahnschmelz. Fluorid hemmt wiederum das Wachstum von Kariesbakterien und härtet den Zahnschmelz. Daneben ist Molybdän Teil mehrerer Enzyme. Es könnte zum Beispiel bei einer Sulfitempfindlichkeit helfen: Ein molybdänhaltiges Enzym fördert den Abbau von Sulfit, wodurch möglicherweise die Beschwerden gelindert werden.
Verzeichnis der Studien und Quellen
Abumrad, N.N. (1984): Molybdenum--is it an essential trace metal? Bull N Y Acad Med. 1984 Mar;60(2):163–71. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1911702/?page=1, abgerufen am 26.07.2021.
Al-Saleh, E. et al. (2007): Maternal-foetal status of copper, iron, molybdenum, selenium and zinc in obese gestational diabetic pregnancies. Acta Diabetol. 2007 Sep;44(3):106-13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17721748/, abgerufen am 26.07.2021.
Association for the Advancement of Restorative Medicine (AARM) (o.J.): Molybdenum. https://restorativemedicine.org/library/monographs/molybdenum/, abgerufen am 26.07.2021.
Battelli, M.G. et al. (2015): Xanthine Oxidoreductase-Derived Reactive Species: Physiological and Pathological Effects. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2015 Dec;2016: 3527579. https://www.hindawi.com/journals/omcl/2016/3527579/, abgerufen am 26.07.2021.
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) (2018): Sulfit im Wein. https://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/warengruppen/wc_33_weine/archiv/et_sulfit_wein.htm, abgerufen am 26.07.2021.
Bender, D. & Schwarz, G. (2018): Nitrite-dependent nitric oxide synthesis by molybdenum enzymes. FEBS Lett. 2018 Jun;592(12):2126-39. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29749013/, abgerufen am 26.07.2021.
Bhattacharya, P.T. et al. (2016): Nutritional Aspects of Essential Trace Elements in Oral Health and Disease: An Extensive Review. Scientifica (Cairo). 2016;2016:5464373. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4940574/, abgerufen am 26.07.2021.
Bobyleva, V.R. (1968): The role of indium, gallium, molybdenum, rubidium and circonium in the prevention of experimental caries in rats. Stomatologiia (Mosk). Sep-Oct 1968;47(5):19-22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5246881/, abgerufen am 26.07.2021.
Broderick, T.L. et al. (2006): Effect of a novel molybdenum ascorbate complex on ex vivo myocardial performance in chemical diabetes mellitus. Drugs R D. 2006;7(2):119-25. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16542058/, abgerufen am 26.07.2021.
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) (2006): Use of Minerals in Foods. https://www.bfr.bund.de/cm/350/use_of_minerals_in_foods.pdf, abgerufen am 26.07.2021.
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) (2021): Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln. Presseinformationen 11/2021. https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2021/11/hoechstmengen_fuer_vitamine_und_mineralstoffe_in_nahrungsergaenzungsmitteln_und_angereicherten_lebensmitteln-269582.html, abgerufen am 26.07.2021.
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) (2021): Höchstmengenvorschläge für Molybdän in Lebensmitteln inklusive Nahrungsergänzungsmittel. https://www.bfr.bund.de/cm/343/hoechstmengenvorschlaege-fuer-molybdaen-in-lebensmitteln-inklusive-nahrungsergaenzungsmittel.pdf, abgerufen am 26.07.2021.
Chen, C. et al. (2016): Hyperuricemia-Related Diseases and Xanthine Oxidoreductase (XOR) Inhibitors: An Overview. Med Sci Monit. 2016;22:2501–12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4961276/, abgerufen am 26.07.2021.
Chung, H.Y. et al. (1997): XANTHINE DEHYDROGENASE/XANTHINE OXIDASE AND OXIDATIVE STRESS. Age. 1997;20:127-40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3455892/pdf/11357_1997_Article_12.pdf, abgerufen am 26.07.2021.
Davies, B.E. & Anderson, R.J. (1987): The epidemiology of dental caries in relation to environmental trace elements. Experientia. 1987 Jan 15;43(1):87-92. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3792506/021, abgerufen am 26.07.2021.
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) (2000): Kupfer, Mangan, Chrom, Molybdän. https://www.dge.de/wissenschaft/referenzwerte/kupfer-mangan-chrom-molybdaen/?L=0, abgerufen am 26.07.2021.
European Food Safety Authority (EFSA) (2006): TOLERABLE UPPER INTAKE LEVELS FOR VITAMINS AND MINERALS. https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/efsa_rep/blobserver_assets/ndatolerableuil.pdf, abgerufen am 26.07.2021.
Gabovich, R.D. & Stepanenko, G.A. (1970): Experimental studies of the anti-caries effect of fluorine-containing reagents of molybdenum and strontium. Gig Sanit. 1970 Jun;35(6):82-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5479409/, abgerufen am 26.07.2021.
Gartner, E.M. et al. (2008): A pilot trial of the anti-angiogenic copper lowering agent tetrathiomolybdate in combination with irinotecan, 5-flurouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. Invest New Drugs. 2009 Apr;27(2):159-65. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18712502/, abgerufen am 26.07.2021.
Institute of Medicine (US) Panel on Micronutrients. (2001): Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington (DC): National Academies Press (US); 2001. 11, Molybdenum. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222301/, abgerufen am 26.07.2021.
Jain, S. et al. (2013): Tetrathiomolybdate-associated copper depletion decreases circulating endothelial progenitor cells in women with breast cancer at high risk of relapse. Ann Oncol. 2013 Jun;24(6):1491-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23406736, abgerufen am 26.07.2021.
Kim-Shapiro, D.B. & Gladwin M.T. (2014): Mechanisms of Nitrite Bioactivation. Nitric Oxide. 2014 Apr 30;0:58–68. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3999231/, abgerufen am 26.07.2021.
Kones, R. (1987): Molybdenum in Human Nutrition. JOURNAL OF THE NATIONAL MEDICAL ASSOCIATION. 1984;82(1). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2625930/pdf/jnma00887-0013.pdf, abgerufen am 26.07.2021.
Lan, C. et al. (2021): Internal metal(loid)s are potentially involved in the association between ambient fine particulate matter and blood pressure: A repeated-measurement study in north China. Chemosphere. 2021 Mar;267:129146. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33338725/, abgerufen am 26.07.2021
MacDonald, K. et al. (2006): A newly synthesised molybdenum/ascorbic acid complex alleviates some effects of cardiomyopathy in streptozocin-induced diabetic rats. Drugs R D. 2006;7(1):33-42. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16620135/, abgerufen am 26.07.2021.
Mendel, R.R. & Bittner, F. (2006): Cell biology of molybdenum. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research. 2006 Jul;1763(7):621-35. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167488906001017, abgerufen am 26.07.2021.
Mendel, R.R. (2013): The Molybdenum Cofactor. J Biol Chem. 2013 May;288(19):13165–72. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3650355/, abgerufen am 26.07.2021.
Menke, A. et al. (2016): Metals in Urine and Diabetes in U.S. Adults. Diabetes. 2016 Jan; 65(1):164-71. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4686948/, abgerufen am 26.07.2021.
National Institute of Health (NIH). (2021): Molybdenum. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Molybdenum-HealthProfessional/, abgerufen am 26.07.2021.
Nishino, T. & Okamoto, K. (2014): Mechanistic insights into xanthine oxidoreductase from development studies of candidate drugs to treat hyperuricemia and gout. J Biol Inorg Chem. 2015 Mar;20(2):195-207. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25501928/, abgerufen am 26.07.2021.
Odularu, A.T. et al. (2019): Impact of Molybdenum Compounds as Anticancer Agents. Bioinorg Chem Appl. 2019;2019:6416198. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6754869/, abgerufen am 26.07.2021.
Oguro, T. et al. (1994): Molybdate depletes hepatic 3-phosphoadenosine 5-phosphosulfate and impairs the sulfation of acetaminophen in rats. J Pharmacol Exp Ther. 1994 Sep;270(3):1145-51. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7932164/, abgerufen am 26.07.2021.
Orphanet. Das Portal für seltene Krankheiten und Orphan Drugs (Hrsg.) (2021): Zyklisches Pyranopterinmonophosphat. https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=DE&Expert=230780, abgerufen am 27.07.2021.
Pan, Q. et al. (2002): Copper deficiency induced by tetrathiomolybdate suppresses tumor growth and angiogenesis. Cancer Res. 2002 Sep;62(17):4854-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12208730/, abgerufen am 26.07.2021.
Pappalardo, G. et al. (1968): The combined action of magnesium fluosilicate and molybdenum in the treatment of experimental caries in the white rat. Minerva Stomatol. 1968 Dec;17(12):933-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4305802/1968 , abgerufen am 26.07.2021.
Qiao, Y.L. et al. (2009): Total and cancer mortality after supplementation with vitamins and minerals: follow-up of the Linxian General Population Nutrition Intervention Trial. J Natl Cancer Inst. 2009 Apr 1;101(7):507-18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19318634/, abgerufen am 26.07.2021.
Reisfeld, S. et al. (1965): The effectiveness of a dentifrice containing sodium fluoride and molybdenum in preventing dental caries in the Syrian hamster. Alpha Omegan. 1965 Sep;58(2):135-6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/5213793/, abgerufen am 26.07.2021.
Rickhoff, S. et al. (2021): Leistungsverzeichnis. https://www.laboraerzte-schweinfurt.de/fileadmin/user_upload/schweinfurt/Dateien/Leistungsverzeichnis.pdf, abgerufen am 26.07.2021.
Riyat, M. & Sharma, D.C. (2009): Analysis of 35 inorganic elements in teeth in relation to caries formation. Biol Trace Elem Res. Summer 2009;129(1-3):126-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19129982/, abgerufen am 26.07.2021.
Schneider, B.J. et al. (2013): Pre-operative chemoradiation followed by post-operative adjuvant therapy with tetrathiomolybdate, a novel copper chelator, for patients with resectable esophageal cancer. Invest New Drugs. 2013 Apr;31(2):435-42. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22847786/, abgerufen am 26.07.2021.
Stookey, G.K. et al. (1962): Synergistic effect of molybdenum and fluoride on dentav caries in rat. Proc Soc Exp Biol Med. 1962 Mar;109:702-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13917487/, abgerufen am 26.07.2021.
Thorne Research, Inc. (2006): Molybdenum. MolybdenumAlternative Medicine Review. 2006;11(2). http://archive.foundationalmedicinereview.com/publications/11/2/156.pdf, abgerufen am 26.07.2021.
Turnlund, J.R. & Keyes, W.R. (2006): Dietary Molybdenum. Trace Elements in Man and Animals. 2006 Apr;10:951-3. https://link.springer.com/chapter/10.1007/0-306-47466-2_297, abgerufen am 26.07.2021.
Turnlund, J.R. et al. (1995): Molybdenum absorption, excretion, and retention studied with stable isotopes in young men at five intakes of dietary molybdenum. American Journal of Clinical Nutrition. 1995 Oct;62(4):790-6. https://www.researchgate.net/publication/15625829_Molybdenum_absorption_excretion_and_retention_studied_with_stable_isotopes_in_young_men_at_five_intakes_of_dietary_molybdenum, abgerufen am 26.07.2021.
Uemura, M. et al. (1989): Effects of molybdenum on human enamel fluoride uptake and experimental rat dental caries. Arch Oral Biol. 1989;34(8):665-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2597057/, abgerufen am 26.07.2021.
Wang, J. et al. (2019): Alteration of the Antioxidant Capacity and Gut Microbiota under High Levels of Molybdenum and Green Tea Polyphenols in Laying Hens. Antioxidants (Basel). 2019 Oct;8(10):503. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6826559/, abgerufen am 26.07.2021.
Weiss, K.H. et al. (2017): Bis-choline tetrathiomolybdate in patients with Wilson's disease: an open-label, multicentre, phase 2 study. The Lancet Gastroenterology and Hepatology. 2017 Dec;2(12):869-76. https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(17)30293-5/fulltext, abgerufen am 26.07.2021.
Wu, S. et al. (2013): Blood pressure changes and chemical constituents of particulate air pollution: results from the healthy volunteer natural relocation (HVNR) study. Environ Health Perspect. 2013 Jan;121(1):66-72. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23086577/, abgerufen am 26.07.2021.
Zimmermann, M. et al. (2018): Burgerstein, Handbuch Nährstoffe. 13. Aufl. TRIAS Verlag Stuttgart.


